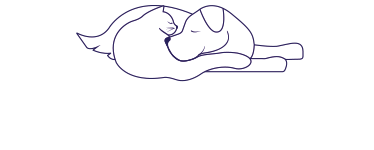AW: Sagen und Legende
Der Almgeist
Wenn im Spätherbst die Sennen mit dem prächtig genährten Weidevieh ins Tal gezogen sind, beginnt eines Tages hoch oben in den verlassenen Almhütten ein recht unheimliches Leben und Treiben. Denn der Almgeist geht um und bringt Herden, Knechte und Mägde und die nötigen Geschirre und Gerätschaften mit sich. Findet er eine Hütte, die weder durch ein Kreuzzeichen noch durch die Anfangsbuchstaben der Dreikönigsnamen gegen nächtlichen Spuk gefeit ist, dann nimmt er mit seiner Geisterschar darin Wohnung und das unselige Gesinde muß melken und Butter rühren und Käse bereiten. Und ist das geschehen, so befiehlt der Almgeist mit drohenden Worten, die Milchgeschirre blitzblank zu säubern und die Kühe zu striegeln und ihnen frische Streu einzulegen. Alle diese Arbeiten werden unter Schimpfen, Heulen und Fluchen getan - und dann zieht die gespenstische Schar zur nächsten Hütte!
Trifft der Almgeist auf seinen Streifzügen einen Menschen, so ist's um den geschehen! Er gehört fortan zum Gefolge des rätselvollen Geistes und muß ihn bis zum Jüngsten Tag begleiten und mit den anderen schreien, streiten und Nacht für Nacht bis zur Erschöpfung arbeiten. Überdies darf der Arme sich gar manche Tracht Prügel gefallen lassen! Einmal aber gelang es einem Jäger auf der Rettenbachalm bei Ischl, den Almgeist samt seinem lärmenden Gesinde zu vertreiben; denn er hatte zum Glück einen Dackel, dem zwei helle Flecken über den Augen saßen, bei sich - und außerdem ein Dreikreuzmesser!
Alle unholden Geister fürchten ein Dreikreuzmesser über die Maßen! Denn weißt du: die drei Kreuze, die in Griff oder Klinge des Messers eingeprägt sind, haben große Macht! Sie stillen das Bluten einer Wunde, sie heilen Geschwülste, sie lassen Verlorenes auffinden - und sie verscheuchen sogar den Teufel samt all seinen bösen Engeln. Und wird solch ein Messer gestohlen, so verwundet sich der Dieb damit selbst und der Stich kann nie mehr vernarben.
Wie gut also, daß der Jägersmann gerade damals sein Dreikreuzmesser bei sich trug, als der Geisterschwarm daherbrauste! Von weitem schon sah es der Almgeist in des jungen Jägers Hand blinken; da rief er seiner Horde mit machtvoller Stimme zu: "Dort sitzt einer mit einem vieräugigen Beißer und einem Dreikreuzmesser - fort, nur geschwind fort mit uns allen!" Im Nu entschwand die Gespensterschar klagend in die dunkle Nacht. Der Jäger blieb damit vor ewiger Knechtschaft bewahrt. Heutzutage gibt es nur mehr wenige echte Dreikreuzmesser im Salzkammergut. Und so ist es geraten, die verlassenen Almhütten im Spätherbst und Winter lieber zu meiden; denn der Almgeist geht um! Auch noch in unseren Tagen!
Quelle: Sagenschatz aus dem Salzkammergut, Iolanthe Hasslwander, Steyr 1981
Wenn im Spätherbst die Sennen mit dem prächtig genährten Weidevieh ins Tal gezogen sind, beginnt eines Tages hoch oben in den verlassenen Almhütten ein recht unheimliches Leben und Treiben. Denn der Almgeist geht um und bringt Herden, Knechte und Mägde und die nötigen Geschirre und Gerätschaften mit sich. Findet er eine Hütte, die weder durch ein Kreuzzeichen noch durch die Anfangsbuchstaben der Dreikönigsnamen gegen nächtlichen Spuk gefeit ist, dann nimmt er mit seiner Geisterschar darin Wohnung und das unselige Gesinde muß melken und Butter rühren und Käse bereiten. Und ist das geschehen, so befiehlt der Almgeist mit drohenden Worten, die Milchgeschirre blitzblank zu säubern und die Kühe zu striegeln und ihnen frische Streu einzulegen. Alle diese Arbeiten werden unter Schimpfen, Heulen und Fluchen getan - und dann zieht die gespenstische Schar zur nächsten Hütte!
Trifft der Almgeist auf seinen Streifzügen einen Menschen, so ist's um den geschehen! Er gehört fortan zum Gefolge des rätselvollen Geistes und muß ihn bis zum Jüngsten Tag begleiten und mit den anderen schreien, streiten und Nacht für Nacht bis zur Erschöpfung arbeiten. Überdies darf der Arme sich gar manche Tracht Prügel gefallen lassen! Einmal aber gelang es einem Jäger auf der Rettenbachalm bei Ischl, den Almgeist samt seinem lärmenden Gesinde zu vertreiben; denn er hatte zum Glück einen Dackel, dem zwei helle Flecken über den Augen saßen, bei sich - und außerdem ein Dreikreuzmesser!
Alle unholden Geister fürchten ein Dreikreuzmesser über die Maßen! Denn weißt du: die drei Kreuze, die in Griff oder Klinge des Messers eingeprägt sind, haben große Macht! Sie stillen das Bluten einer Wunde, sie heilen Geschwülste, sie lassen Verlorenes auffinden - und sie verscheuchen sogar den Teufel samt all seinen bösen Engeln. Und wird solch ein Messer gestohlen, so verwundet sich der Dieb damit selbst und der Stich kann nie mehr vernarben.
Wie gut also, daß der Jägersmann gerade damals sein Dreikreuzmesser bei sich trug, als der Geisterschwarm daherbrauste! Von weitem schon sah es der Almgeist in des jungen Jägers Hand blinken; da rief er seiner Horde mit machtvoller Stimme zu: "Dort sitzt einer mit einem vieräugigen Beißer und einem Dreikreuzmesser - fort, nur geschwind fort mit uns allen!" Im Nu entschwand die Gespensterschar klagend in die dunkle Nacht. Der Jäger blieb damit vor ewiger Knechtschaft bewahrt. Heutzutage gibt es nur mehr wenige echte Dreikreuzmesser im Salzkammergut. Und so ist es geraten, die verlassenen Almhütten im Spätherbst und Winter lieber zu meiden; denn der Almgeist geht um! Auch noch in unseren Tagen!
Quelle: Sagenschatz aus dem Salzkammergut, Iolanthe Hasslwander, Steyr 1981