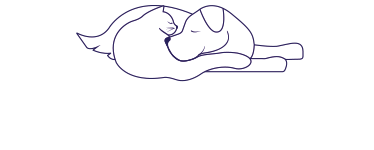Der Wein und der Teufel
Die Welt war schon erschaffen, und Gott schickte sich an, einen Weinberg anzulegen. Da fragte der Teufel: "Was tust du da?"
"Ich pflanze Weintrauben", sagte Gott, "es wird Zeiten geben, da braucht der Mensch Wein, damit es ihm wieder etwas besser geht."
"Hast du etwas dagegen, daß ich dir helfe?"
Gott dachte einen Augenblick nach.
"Was er wohl vor hat?" überlegte er. Na, was konnte schon Schlimmes passieren. Also antwortete er: "Von mir aus... du darfst helfen."
"Du wirst erstaunt sein, welche Hilfe du an mir hast", sagte der Teufel und machte sich augenblicklich an die Arbeit.
Zuerst tötete er eine Spottdrossel und ließ das Blut in die Reihen tropfen.
Dann tötete er einen Löwen und ein Schwein und sprengte ihr Blut aus von einem Ende des Weinberges bis zum anderen.
"Jetzt bin ich fertig", sprach er. "Jetzt können wir nichts anderes tun, als abzuwarten."
Alle wissen nur zu gut, was geschah.
Wenn die Menschen anfangen zu trinken, verspüren sie zuerst die Wirkung des Vogelblutes und fangen an zu singen. Trinken sie weiter, so kommt das Löwenblut zur Wirkung. Die Trinker fangen sich an zu streiten und zu schlagen. Trinken aber die Menschen immer noch weiter, beginnt auch das Schweineblut zu wirken, und die Zecher landen irgendwo in der Gosse.
Ay qué mala suerte!
(Mexico)
Die Welt war schon erschaffen, und Gott schickte sich an, einen Weinberg anzulegen. Da fragte der Teufel: "Was tust du da?"
"Ich pflanze Weintrauben", sagte Gott, "es wird Zeiten geben, da braucht der Mensch Wein, damit es ihm wieder etwas besser geht."
"Hast du etwas dagegen, daß ich dir helfe?"
Gott dachte einen Augenblick nach.
"Was er wohl vor hat?" überlegte er. Na, was konnte schon Schlimmes passieren. Also antwortete er: "Von mir aus... du darfst helfen."
"Du wirst erstaunt sein, welche Hilfe du an mir hast", sagte der Teufel und machte sich augenblicklich an die Arbeit.
Zuerst tötete er eine Spottdrossel und ließ das Blut in die Reihen tropfen.
Dann tötete er einen Löwen und ein Schwein und sprengte ihr Blut aus von einem Ende des Weinberges bis zum anderen.
"Jetzt bin ich fertig", sprach er. "Jetzt können wir nichts anderes tun, als abzuwarten."
Alle wissen nur zu gut, was geschah.
Wenn die Menschen anfangen zu trinken, verspüren sie zuerst die Wirkung des Vogelblutes und fangen an zu singen. Trinken sie weiter, so kommt das Löwenblut zur Wirkung. Die Trinker fangen sich an zu streiten und zu schlagen. Trinken aber die Menschen immer noch weiter, beginnt auch das Schweineblut zu wirken, und die Zecher landen irgendwo in der Gosse.
Ay qué mala suerte!
(Mexico)