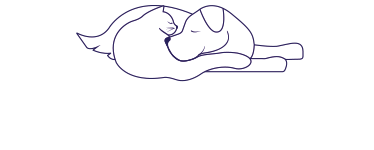AW: Sagen und Legende
Die Rosen von Pougues
Nördlich von Nevers, genau in der Mitte Frankreichs, liegt die kleine Stadt Pougues, im Sommer wegen ihrer Mineralquellen stark besucht. Das kalte eisenhaltige Wasser wird gegen Nierenleiden empfohlen. Die Stadt lehnt sich an einen Berg, von dem aus man die Loire sieht, die sich wie ein silbernes Band durch das Tal schlängelt. Über dem Tal erhebt sich der alte Turm des hochgelegenen Ortes Cancerre, er blickt hinüber zu den südlichen Turmspitzen von Nevers und zu den Bergkuppen der Auvergne, die blau und fern emporragen.
Eines Tages klagte Heinrich der Dritte, König von Frankreich, über Nierenschmerzen. "Ach, Miron", sagte er zu seinem Leibarzt, "ich glaube, ich bin verhext."
Der würdige Doktor lächelte fein. "Was eure Hoheit krank macht, sind keine Hexenmeister, sondern hübsche, ganz wirkliche Hexen. Bleibt ein paar Tage ganz ruhig und trinkt das Wasser von Pougues."
Das tat der König, und das Wasser bekam ihm so gut, daß seine Mutter, Katharina von Medici, die sich ebenfalls behext fühlte, auch davon trank. Auch ihre Leiden wurden dadurch gelindert, und sie ließ für die Bequemlichkeit der anreisenden Kranken eine Anstalt bauen, von der man heute nur noch verfallene Mauern sehen kann. Aber der Ruf der Quellen war begründet, und berühmte Zeitgenossen hielten sich dort in den folgenden Jahrhunderten auf.
Den Kurgästen, die heute auf jenem Berg Blumen pflücken und die herrliche Aussicht genießen, ist dieser Werdegang kaum geläufig. Eher erfahren sie eine andere, viel wehmütigere Geschichte. Sie hat mit dem Duft der Rosen zu tun, die auf dem Berg wachsen, weißer Rosen, wie man sie schöner nirgends sehen kann . . .
Vor langer Zeit lebte in dieser Gegend ein Ritter. Er hatte drei Töchter, die sehr schön waren. Besonders die jüngste, Emma mit Namen, gefiel allen jungen Männern. Eines Tages, als Emma sechzehn war, zog der Ritter nach Spanien und ließ seine Töchter mit dem Burgkaplan allein. Die Mutter war seit fünf Jahren tot.
In der Nacht, als der Vater genau zwei Wochen im Süden weilte, hatten die drei Schwestern den gleichen Traum. Sie träumten, eine von ihnen würde vom Blitz erschlagen werden. Weinend umarmten sie sich. "Wenn es nur nicht Emma ist!" riefen die beiden älteren, "der Vater hat sie so gern. Wenn es uns trifft, wird er weinen, trifft es sie, so stirbt er vor Schmerz."
Gegen Mittag des nächsten Tages belud sich der Himmel mit dicken, schwarzen Wolken, ein Gewitter zog grollend herauf. Direkt über dem Haus entlud es sich. Noch nie hatte der Donner so furchtbar über dem Land getobt, und doch wehte kein Lüftchen, kein Tropfen Regen fiel.
Die älteste Schwester sagte: "Ich will dem Schicksal gehorchen, ich gehe hinaus." Sie setzte sich auf eine Bank, mitten im Park. Den ganzen Tag saß sie dort; das Gewitter tobte ununterbrochen. Sie wartete aber vergebens, kein tödlicher Blitzschlag traf sie.
Die zweite ging hinaus. "Mich ruft der Donner, ich muß ihm gehorchen." Der Donner rollte fön und fön über den schwarzen Wolkenhimmel, aber kein Blitz fuhr zu dem Mädchen nieder, obwohl sie die ganze Nacht draußen ausharrte.
Da sagte Emma: "Seht ihr nun, ich bin es, die sterben wird. Lebt wohl, Schwestern, denkt bisweilen an mich." Sie zog ihr schönstes Kleid an, schmückte ihr blondes Haar mit einem Kranz weißer Rosen und ging zu der Bank im Park hinüber.
Kaum hatte sie Platz genommen, als ein furchtbarer Donnerschlag die Luft erschütterte und ein flammender Blitz auf das juhge Mädchen niederfuhr. Sofort danach teilten sich die Wolken, der Himmel erstrahlte in reinstem Blau, der Ort, wo das Mädchen gesessen hatte, war leer - bis auf den weißen Rosenkranz.
Seit diesem Tag geschah es, daß man jedesmal, wenn ein Gewitter die Gegend bedrohte, den Schatten eines weißgekleideten, mit Rosen bekränzten Mädchens durch den Park irren sah. Sie ging über die Täler, sie beschützte die Ernte der Bauern, Kinder, die der Donner ängstigte, schaukelte sie in die Wiege; sie hielt die Bäume am Boden fest, die der Sturm entwurzeln wollte, überströmende Bäche hielt sie in ihrem Bett zurück. Auch der Zaghafteste faßte wieder Lebensmut, wenn er der weißen, nächtlichen Erscheinung begegnet war.
Einmal kam ein armer Bauer den bewaldeten Hügel herab, über den die Straße von Nevers führt, und wollte in sein Dorf. Er trieb seine Ziegen vor sich her - oder vielmehr: er ließ sich von ihnen leiten, denn Trauer zerfraß sein Herz, Er wollte Bertha, seine hübsche Freundin heiraten, die er mehr liebte als seine ganze Herde. Aber am nächsten Tag wollten die Herrschenden der Gegend seine Herde pfänden, und er konnte sich dagegen nicht wehren. Ohne Herde, ohne Geld, wie sollte er da heiraten?
Von solchen Gedanken geplagt, ging er weinend den Weg hinunter. Er bemerkte die große, schwarze Wolke nicht, die von Westen heraufzog und in der ein dumpfer Donner rollte. Weiter schritt er seinen Tieren nach, die Wolke kam immer näher. Plötzlich, als der Bauer aufblickte, fand er sich in der Nähe der alten Burg wieder, die gar nicht auf seinem Weg lag. Und auf einmal brach das Gewitter mit derartiger Gewalt aus, wie er es noch nie erlebt hatte. Dabei wehte kein Lüftchen, kein Tropfen Regen war zu spüren.
Der Bauer war zu bekümmert, um ängstlich zu sein, seine Alltagssorgen waren stärker, als alle Furcht vor dem Unwirklichen. Dennoch blieb er erschrocken stehen, als er beim Schein eines Blitzes eine ganz weiß gekleidete junge Frau auf dem Weg stehen sah. Als er nah bei ihr war, nahm sie ihre Kopfbedeckung ab. "Hör mal, Bauer, ich will dir etwas schenken. Siehst du die Rosen hier? Willst du sie haben?"
"Sie sind sehr schön, fremde Dame. Aber - Rosen für mich?
Morgen verkauft man meine Herde, man wird auch mein Bett verkaufen, mein Haus! Nein, ich brauche keine Rosen!"
"Nimm sie nur", sagte die Frau beharrlich. Ein trauriges Lächeln lag auf ihren Zügen.
"Nun gut, ich will eine für meine Bertha nehmen. So hab' ich wenigstens etwas, das ich ihr schenken kann. Eine Blume wird man mir wohl nicht pfänden. Und wenn ich das Tal verlassen habe, wird Bertha etwas haben, das sie an mich erinnert."
"Hier, Bauer, da ist eine für deine Freundin, eine für dich, für deine Mutter eine, diese da ist für deine Gläubiger, und die anderen behalte zum Andenken an die weiße Dame. Du bist der letzte, der mich sieht. Meine Zeit ist vorüber. Heute, auf die Stunde genau vor zehn Jahren, hat mich auf dieser Bank der Blitz..."
Ein furchtbarer Donnerschlag beendete ihre Worte. Erschrocken fuhr der Bauer zusammen. Als er die Augen wieder hob, war die Erscheinung verschwunden, das Haus selbst in Schutt und Asche versunken. Das Gewitter war spurlos vorüber.
In seiner Hand hielt der arme Bauer acht schwere, goldene Rosen. Er schenkte die erste seiner Berta, behielt eine für sich, gab eine andere seiner Mutter, die dritte seinen Gläubigern und die restlichen behielt er als Andenken an die weiße Dame von Pougues, die nicht wieder gesehen wurde, auch nicht bei der Hochzeit des Bauern, acht Tage später.
Die Trümmer des Hauses bedeckten sich mit Gras und Blumen. Keine Blume wird dort so heimisch wie die weiße Rose, die in vollen, duftenden Büschen aus den Ruinen hervorwächst. Der ganze Berg steht voll davon.
Quelle: (eine Sage aus dem Rivernais, in: Herman Semmig, Fern von Paris, Leipzig o. J. Frankreich)